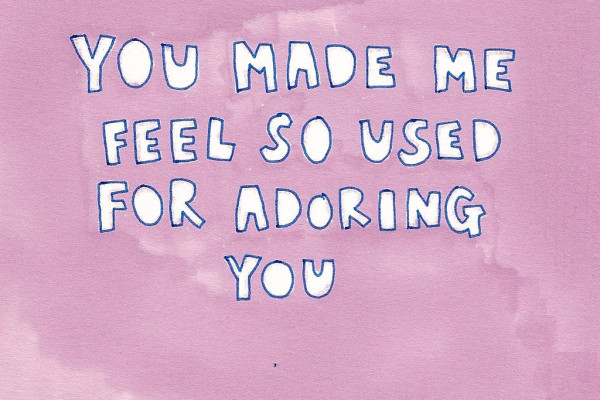Als Kind wollte ich mir mein Studium immer mit strippen finanzieren. Ich weiß nicht, woher ich im zarten Alter von zehn Jahren diese Idee hatte, wahrscheinlich hatten meine Eltern mich nach 24 Uhr beim Fernsehen nicht genug beaufsichtigt, aber ich fand meinen Plan grandios.
Ich malte mir die erwachsene Myri aus, wie sie in Glitzerpuder und mörderischen Plateau-High-Heels an der Stange auf und ab glitt und sich die lila Lippen leckte. In meiner Phantasie trug ich eine bunte Perücke, die den Männern sagte “Du siehst mich vielleicht nackt, aber du kennst mich nicht” und meine Blickte konnten gleichermaßen Willen schmelzen und Geldbörsen leeren.
In meinen kindlichen Augen war das Tanzen und Strippen ein wunderbarer Beruf, eine ästhetische Kunstform und etwas, über das ich ohne zu zögern in “Was ich einmal werden will, wenn ich groß bin”-Aufsätzen geschrieben hätte. Wahrscheinlich danken meine Eltern heute Gott und meinen Grundschullehrern, dass ich nie gebeten wurde, einen solchen Aufsatz zu verfassen.
Immerhin wusste ich da noch nicht, dass der weibliche Körper etwas ist, was jeder unbedingt zu sehen bekommen will, die Frau jedoch schließlich dafür verachtet wird, wenn sie diesem Wunsch nachkommt. Mit zehn wusste ich, dass Frauen wunderschön sind und dass Tanzen Spaß macht, dass ich studieren wollte und dass dafür Geld nötig ist und dass Männer manchmal dafür bezahlten, Frauen nackt und tanzend zu sehen. In meiner Logik fügte sich das alles perfekt zusammen. In meine Logik hatte das Tabu der selbstbestimmten weiblichen Sexualität noch keinen Einzug erhalten und es würde noch ein paar Jahre dauern, bis ich der Gesellschaft glaubte, dass solche Frauen Schlampen waren und wiederum ein paar Jahre, bis ich verstand, dass das frauenverachtende Gehirnwäsche war.
Irgendwo tief in mir verankert ist immer noch dieser Kindheitstraum, verankert wie die Strip Pole im Boden der zahlreichen Striptease Bars.
Als eine Freundin mir beim Feiern betrunken anvertraute, dass sie während des Studiums für Geld getanzt hat, sah ihr Gesicht dabei beschämt aus, in ängstlicher Erwartung meiner Reaktion.
Wahrscheinlich hatte sie nicht erwartet, dass ich begeistert in die Hände klatschend auf und ab springen würde, immer wieder “Oh du meine Güte, wie geil bist du denn?!” rufend.
Sie starrte mich an. Und ich starrte sie an, nur mit diesem “You go, girl!”-Ausdruck in den Augen, mit dem ich wohl all meine Freundinnen angucke.
In dem Moment wurde mir klar, dass sie sich schämte. Weil andere Leute ihr zu verstehen gegeben hatte, dass das, was sie getan hatte, beschämend sei.
“Girls, girls, get that cash – whether it's 9 to 5 or shaking your ass!
Ain't no shame, ladies do your thing, just make sure you're ahead of the game.”
– Missy Elliot
Nach einem kurzen Monolog darüber, wie sehr ich sie bewunderte und wie powerful sie sich doch gefühlt haben musste, dass Leute sie so schön fanden, dass sie ihr Geld dafür ausgaben, sie tanzen zu sehen, fiel mir nur noch eine Möglichkeit ein, ihr diese von anderen infiltrierte Scham zu nehmen: Wir gingen auf die Tanzfläche. Und ich hoffe, dass sie in meinen Augen gespiegelt gesehen hat, wie anmutig und wundervoll und schön und begehrenswert und weiblich und eigenständig und bewundernswert sie dabei und in jedem anderen Moment war.
Ich habe es auf jeden Fall gesehen, in diesem und in jedem anderen Moment.
Titelbild: _dChris via flickr.com (CC-BY 2.0)